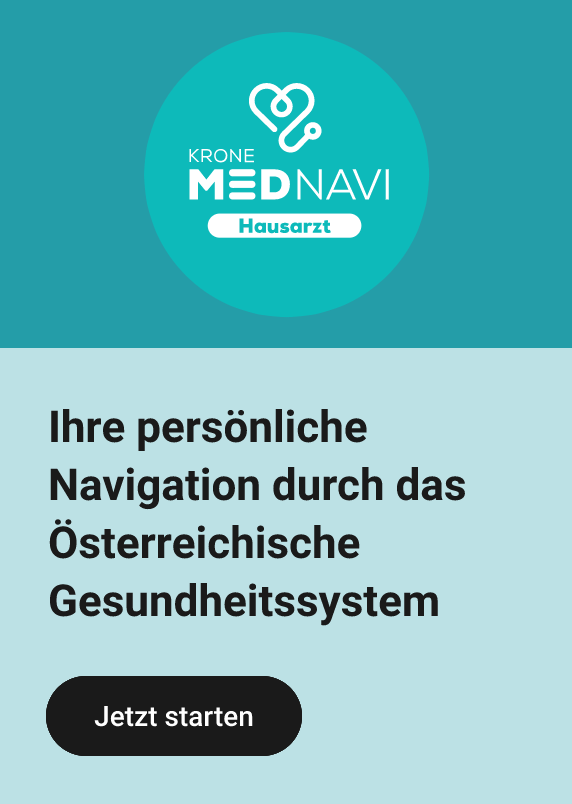Magen, Darm, Leber
Was kann ich gegen Sodbrennen tun?
Die gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD) zählt weltweit zu den am häufigsten vorkommenden Krankheiten des Magen-Darmtraktes. Zu den Risikofaktoren zählen vor allem zunehmendes Alter, männliches Geschlecht, Übergewicht und Rauchen.
„GERD liegt vor, wenn durch Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre belästigende Symptome und/oder Läsionen (Gewebsschäden) in der Speiseröhre auftreten“, heißt es in der aktuell gültigen Leitlinie „Gastroösophageale Refluxkrankheit“. Trotz der geringen Sterblichkeit bei GERD ist eine Behandlung meist erwünscht, da die Krankheit die Lebensqualität verschlechtert. Eine Schwierigkeit der GERD-Therapie stellt die Diagnose dar. Die typischen Refluxbeschwerden (z.B. „Sodbrennen“) sind ungeeignet für die Diagnose, da sie diese nicht zuverlässig absichern. Die Leitlinien empfehlen eine Unterscheidung in die Therapie von Refluxbeschwerden ohne gesicherte GERD und die Therapie von einer gesicherten GERD. Diese Unterscheidung soll bei Kindern und Erwachsenen berücksichtigt werden.
Anna-Katharina Mayer, BSc
Redaktion ApoKrone
Der erste Therapieansatz ist sowohl bei Refluxbeschwerden ohne gesicherte Diagnose als auch bei einer gesicherten GERD eine Verbesserung des Lebensstils - soweit möglich:
- Gewichtsreduktion bei Übergewicht
- Höherstellen des Kopfendes des Bettes
- Verzicht auf späte Mahlzeiten
- Linksseitenlage
- Rauchstopp
- Atemtraining (Bauchatmung)
- Vermeiden enger Kleidung
- Individuell unverträgliche bzw. ungesunde Speisen meiden
- Wenig Fett und Zucker, mehr Ballaststoffe
- Für ausreichend Nachtschlaf sorgen
Die Leitlinie für gastroösophageale Refluxkrankheit und eosinophile Ösophagitis rät bei Kindern und erwachsenen Patient:innen ohne familiäre Vorbelastung oder Risikofaktoren für Komplikationen (wie beispielsweise der Barett-Ösophagus) zum Einsatz von Protonenpumpenhemmern (PPI). Das sind Medikamente, die die Säureproduktion im Magen reduzieren. Diese Patientengruppe kann bei subjektiv ausreichender Symptomkontrolle auch mit anderen Antirefluxpräparaten (z. B. H2-Rezeptorantagonisten, Alginate oder Antazida) therapiert werden.
Ist die GERD jedoch wahrscheinlich oder sogar gesichert, so soll mindestens 4 bis 8 Wochen eine PPI-Therapie durchgeführt werden, wobei sich die Dosierung nach Art der Erkrankung und dem verabreichten Arzneimittel richtet. Generell überwiegt bei einer GERD der Nutzen das mögliche, wenn auch sehr geringe, Nebenwirkungsrisiko. Im besten Fall schlägt diese Therapie an. Sollte dies nicht der Fall sein, kann entweder der Arzneistoff gewechselt, die Dosis verdoppelt oder eine Kombinationstherapie mit anderen Refluxhemmern begonnen werden. Es sollte auch unbedingt sichergestellt werden, dass die Medikamenteneinnahme richtig erfolgt (PPI immer 30-60 min vor einer Mahlzeit einnehmen!). Eine weiterführende Diagnostik des/der Patient:in, z. B. eine Gastroskopie (Magenspiegelung) ist dann zu unternehmen, wenn nach mindestens 8 Wochen PPI-Therapie in der doppelten Menge keine ausreichende Besserung zu erkennen ist
PPI hemmen, wie der Name bereits sagt, die Protonenpumpen des Magens. Somit wird die in die Magenhöhle abgegebene Säuremenge reduziert. Ähnlich agieren die H2-Rezeptorantagonisten, welche die Magensäuresekretion infolge einer verringerten Stimulation der salzsäureproduzierenden Zellen durch Histamin hemmen.4 Die bereits erwähnten Antazida machen einen großen Teil der weltweit verkauften OTC-Produkte aus und wirken auf den Magensaft, indem sie überschüssige Salzsäure neutralisieren und die proteolytisch agierenden Pepsine hemmen.5 Ganz anders verhält sich die Arzneistoffgruppe der Alginate. Bei ihnen liegt die Wirkung an der Bildung eines sogenannten „raft“ (Floßes), das auf dem Magenbrei aufschwimmt und somit eine mechanische Barriere bildet. Diese Barriere stoppt das Hochkommen des sauren Mageninhaltes in den Ösophagus.
Da schätzungsweise 40-85 % der Schwangeren an einer GERD leiden, ist es wichtig, diese Patientengruppe hier ebenfalls zu nennen. Die hohe Häufigkeit von GERD während der Schwangerschaft ist vor allem auf hormonelle (höhere Progesteronspiegel) und mechanische Veränderungen zurückzuführen. Bei der Gruppe der schwangeren Frauen verhält es sich in der Therapie der Refluxbeschwerden ganz anders. Die Behandlung schwangerer Patientinnen folgt einem Step-up-Management:
- Allgemeinmaßnahmen
- Antazida/Alginat/Sucralfat
- H2-Rezeptorantagonisten
- PPI